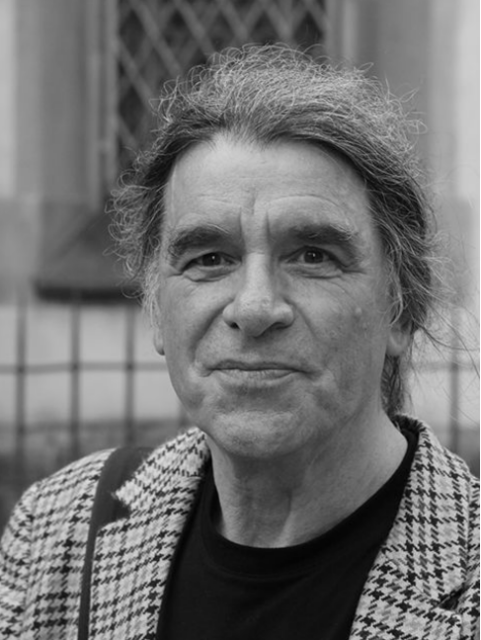Gerald Woehl.
Orgeln sind interessant durch das, was an Sprache, Gesang und Poesie in ihnen lebt. Sie haben ihre eigene Intuition. Dies entdecken Orgelbauer und Organisten gleichermaßen, indem sie dem Instrument als Hörende begegnen. Daraus entsteht eine Synthese des Schöpferischen, eine ergreifende Urkraft, ja das Paradiesische im Erleben des Orgelklangs.
Intuition als schöpferische Kraft
Markus Zimmermann hatte mich angerufen und mir von seinem Projekt für die nächste Ausgabe der Zeitschrift organ erzählt und mich gefragt, ob ich etwas dazu schreiben könnte. “Du hast sehr unterschiedliche Instrumente gebaut. Was denkt ein Orgelbauer, wenn er ein Instrument konzipiert? Wie entsteht es? Wie kommt es zu einer Idee für eine Orgel?“
Diese Frage ist mir oft gestellt worden. In jüngeren Jahren habe ich gesagt: Darüber hab ich mir keine Gedanken gemacht. Zurückblickend kann ich sagen: Projekte habe ich mir nie ausgedacht oder erarbeitet. Erarbeiten kann man nur eine Idee. Orgeln entstehen aus einer Intuition, und die trifft immer den Kern der Persönlichkeit und führt zu der Frage: Wer bin ich?
Intuition ist vor allem Teil der Konzeption, weniger des Baus der Orgel selbst. Eine Orgel ist ein Organismus. Je stimmiger dieser in sich ist, umso besser kann sich in dem Instrument Klang entfalten. Intuition ist entscheidend beim Beginn eines Projektes, bei der ersten Kontaktaufnahme, bei der ersten Besichtigung vor Ort. Je leerer ich mich ihm nähere, desto mehr kann sich Intuition entfalten: ein Gefühl für das Richtige, für das hier Stimmige, das im Moment Passende. Später erweist sich die erste Inspiration meist als Glücksfall, als zeitlos.
Intuition ist wichtig bei der Ausarbeitung des Klangkonzeptes. Ich nenne es “composition“. Sie ist sozusagen die „Partitur“ für das Projekt. In der Werkstatt heißt sie „Klangübersicht“. Die “Instrumentierung und Notation“, die Details werden auf „Mensurblättern“ für jedes Register festgelegt.
Von besonderer Bedeutung ist Intuition bei der klanglichen Ausarbeitung des Instrumentes vor Ort, im Raum, bei der Intonation. In Frankreich sagt man „harmonisation“, Harmonisierung, was die Sache besser beschreibt. Es geht um ein Harmonisieren von Klang, nicht um Gleichmäßigkeit und auch nicht um Schönheit. Intuition ist bei jeder einzelnen Pfeife gefragt : was möchte sie eigentlich und nicht was „muss“ sie. Jede Pfeife in der Orgel hat ihre eigene Intuition, sie aufzufangen und in ein Ganzes zu bringen ist die Aufgabe des „harmonisateurs“. “Harmonisation“ ist, der Intuition freien Lauf zu lassen, gepaart mit einer feinsinnigen Musikalität und dem Wissen, was das Instrument musikalisch ausdrücken möchte. Diese Dualität ist ein schmaler Grad, den es gilt, immer wieder neu auszuloten, zu merken, was ich tun muss. Die intuitive “harmonisation“ muss im Täglichen gepflegt werden und bedarf jedesmal neu einer inneren Vorbereitung. Morgens mit dem Auto irgendwo ankommen und dann anfangen – ich habe bald erkannt, dass das nicht geht. Für die Harmonisierung nehmen wir in der Regel eine Wohnung am Ort, gehen zu Fuß zur klanglichen Ausarbeitung, um auch die Umwelt und die Menschen wahrzunehmen.
Orgeln bauen ist ein langer Prozess der Intuition, der Jahre dauern kann
Bei meinem ersten größeren Projekt 1971 in der Kugelkirche in Marburg habe ich für das „Stimmige“, das „Passende“, ohne genau sagen zu können, was das für ein Instrument sein soll, Jahre gebraucht. Damals, kurz nachdem ich die Werkstätte in Marburg begonnen hatte, stand ich mit leeren Händen da – ohne den künstlerischen Leiter Walter Haerpfer und die traditionsreiche Manufactur de Grandes Orgues in Boulay in Frankreich mit ihren 45 Mitarbeitern, die große französische Orgeln bauten, wo ich gearbeitet hatte und klanglich zu Hause war.
Intuition braucht einen gewissen Hintergrund, einen Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann
Es galt zu erspüren, wie es zunächst innerlich vorangehen muss:
Da gab es ein Weiterkommen im Formalen, in der Gestaltung des Äußeren der Instrumente. Der Architekt und Künstler Le Corbusier hatte mir wichtige Hinweise in meiner Zeit in Frankreich mitgegeben, und in dem Maler und Bildhauer Günter Späth aus Ulm fand ich den Lehrer für Bildhauerarbeiten und Maltechniken an Orgeln.
Eine längere Studienreise führte nach Italien, die italienische Orgel interessierte mich. Dabei beeindruckte das Gesangliche und Vokale der Instrumente. Durch Singen im Chor und intensiven Gesangsunterricht wurden eigene Töne und Klänge hörbar gemacht und verinnerlicht.
Eine weitere Studienreise ging zu spanischen Orgeln. Beeindruckend das stolze, schmetternde Auftreten der Zungenregister “Trompette en chamad“ an den Schauseiten der Instrumente.
Fünf Jahre dauerte der Weg zur Intuition für ein „lateinisches“ Instrument aus der Sicht Anfang der 1970er-Jahre mit italienisch-spanisch-französischen Klängen und Stimmen für die Musik von Johann Sebastian Bach. Mit kostbarem Äußeren, lebendigem Wind, artikulationsfreudiger Spieltraktur und „harmonischer Stimmung“ für die Kugelkirche in Marburg.
Intuition kann etwas Spontanes sein
Drei Jahre später, 1979, eine weitere Anfrage für eine größere Orgel in der St. Remigius Kirche in Viersen am Niederrhein. Bei meinem ersten Besuch und beim Eintritt in den gut proportionierten, spätgotischen Raum kam spontan der Gedanke an mein erstes Konzert an einer Haerpfer Orgel, das mich fasziniert und begeistert hatte, Musik von Jehan Alain, gespielt von Marie Clair Alain. Damals kam der Wunsch auf, eine Orgel speziell für die Musik von Jehan Alain zu bauen. Hier in Viersen war die Gelegenheit dazu.
Intuition muss greifbar, muss materialisiert werden, damit sie für Menschen erlebbar wird
Die französische Orgel war immer noch der Grundstock meines musikalischen Denkens. Das Instrument musste klanglich etwas Ursprüngliches, Klassisches und gleichzeitig Symphonisches haben, um der Musik von Jehan Alain gerecht zu werden. Georges Lhôthe, freischaffender „facteur d‘orgues“ sagte zu, als Begleiter an dem Projekt mitzuwirken. Er war ein besonderer Kenner des französischen Orgelbaus und ein ausgesprochen angenehmer Mensch! Zunächst machten wir gemeinsam Reisen nach Paris, nach Rouen und Can zu den großen Orgeln von Aristide Cavaillé-Coll, um uns einzustimmen, außerdem zu den Orgeln nach Lyon und Toulouse – das besondere Windsystem in diesen Orgeln inspirierte, einer der Schlüssel zur symphonischen Orgel! Und es fanden sich in meiner Bibliothek wichtige Aufzeichnungen und Mensuren aus der Zeit bei Haerpfer in Boulay mit genauen Dokumentationen der Orgel in Nancy St. Epvre, von Joseph Merklin (1867), der Cavaillé-Coll-Mutin-Orgel in der Basilika Sacré-Coeur in Paris und der Orgel in Poitiers von Francois-Henri Clicqout (1791). Haerpfer hatte mich für genaue Dokumentationen dorthin geschickt.
Mit Georges Lhôthe war verabredet, dass man sich in gewissen Abständen mehrere Tage an einem neutralen Ort einquartierte und über die angefertigten Zeichnungen, vor allem aber über die ausgearbeiteten Mensuren und genauen Details der Labial- und Zungenpfeifen sprach. “Grand Orgue, Positif, Bombarde“ sollten mehr klassischer sein, das “Récit“ symphonisch.
1984 war die Fertigstellung: erstmal in Deutschland eine französische klassisch-symphonische Orgel, mit mechanischer Spiel- und Registertraktur und “Appels“, mit klassischem und symphonischem Wind, mit verschieden gebauten Labial- und unterschiedlichen Zungenstimmen. Das Instrument ist Jehan Alain gewidmet.
Sich auf Intuition einzulassen, bringt ganz neue Projekte
1996 – Michael Mages, Kantor an St. Nikolai in Flensburg, fragte um eine Besichtigung und Begutachtung der Orgel in St. Nikolai. Es war ein Erlebnis, beim Einritt in den weiten Kirchenraum den Renaissance-Prospekt von Ringerring (1604–1609) mit dazugehöriger Empore und zwei Rückpositiven mit einer Gesamthöhe von 15 Metern und 7 1/2 Metern Breite unmittelbar wahrzunehmen. Aber von dem monumentalen Hauptgehäuse und den Rückpositivgehäusen gab es nur noch die Schauseiten, der Hauptprospekt drohte auseinander zu brechen, war notdürftig gesichert, und ein Verhau von Windladen und unterschiedlichem Pfeifenwerk ergoss sich wahllos auf dem ehemaligen Platz der historischen Orgelanlage. Mir ward schwindlig…
Ich bat alleine zu sein, um das Chaos zu sichten und stellte fest: Es gab Pfeifen von Schnitger (1709), bzw. Maas (1609), Marcussen (1868), Sauer (1922) und Pfeifen von Kemper (1958). Außerdem, direkt unter der historischen Orgelempore, eine großzügige Sängerempore aus dem 19. Jahrhundert. Vor mir lag ausgebreitet und in Trümmern, die große Flensburger Musik- und Orgeltradition. 400 Jahre – welche Zeitspanne und welche Großartigkeit!
Intuitiv kam der Gedanke: Zwei Orgeln in einer Orgel
- Mit einer Orgel, wie Arp Schnitger das vorhandene Instrument von Maas als eines seiner Spätwerke 1709 neu ordnete,
- und mit einer symphonischen Orgel mit dem Pfeifenwerk von Marcussen, dem ersten Versuch einer Romantisierung im Jahre 1877 und dem Pfeifenwerk von Sauer 1922 im spätromantischen Stil.
- Außerdem die Einbeziehung der Sängerempore von 1877 unter der historischen Orgelanlage.
Um dem Werk die jeweiligen spieltechnisch und klanglich unterschiedlichen Charaktere zu geben, steht auf der historischen Orgelempore eine Spielanlage mit einem Manualumfang C, kurzer Oktave bis c3, dem Pedal C bis d1 ohne Cs und Ds mit klassischen Tastenmensuren. Zu spielen ist die überlieferte Disposition von Schnitger in einer mitteltöniger Stimmung. Das symphonische Instrument mit dem wiederhergestellten Fernwerk von Sauer ist von der darunter liegenden Sängerempore von einem freistehenden Spieltisch mit normalen Tastenumfängen in gleichschwebender Stimmung spielbar. Um die unterschiedlichen Temperierungen zu erreichen, verfügt die Oktave über neunzehn statt über zwölf Töne.
Im Herbst 2009 konnte die 400-jährige monumentale Orgelanlage in St. Nikolai fertiggestellt werden. “Zwei Orgeln in einer Orgel“. Ganze 13 Jahre hatte das Projekt gedauert.
Intuition als ein Vermächtnis
1997 begann der Thomas Organist Ullrich Böhme, Ideen für eine neue Bach Orgel in der Thomaskirche in Leipzig voranzubringen – eine große, gravitätisch klingende Bach Orgel mit vielen Einzelklangfarben. Es sollte eine Orgel im Stil des mitteldeutschen Orgelbaus des 18. Jahrhunderts entstehen. Das Instrument sollte in erster Linie für die Wiedergabe der Musik Johann Sebastian Bachs konzipiert sein. Für das Äußere und das Klangliche der neuen Bach Orgel sollten ein Prospekt und eine Disposition als Vorlage dienen, die nicht mehr erhaltenen sind, aber mit Bach in Verbindung standen. Damit sollte es möglich werden, 250 Jahre nach Bach, ein klanglich schon einmal da gewesenes Instrument aus der Sicht der Jahrtausendwende für sein weit gefächertes Orgelwerk und als Begleitinstrument der aufzuführenden Kantaten neu zu schaffen.
Hier gab es eine klare Zielsetzung für das neue Instrument. Aber was ist eine Bach Orgel? Wie kann sie aussehen, damit nicht gefragt wird, ob auf dieser Orgel Bach gespielt hat? Wie soll sie klingen, wo es doch so unterschiedliche Bachinterpretationen gibt? Hier lag die Intuition in einem Abwägen: Das Instrument sollte barock aussehen, gleichzeitig sollte erkennbar sein, dass es neu aus unserer Zeit gedacht ist.
Die äußere Gestaltung des Instrumentes ist eine Anlehnung an den als Zeichnung überlieferten barocken Prospekt der ehemaligen Orgel der Universitätskirche zu Leipzig. Bach hatte das Instrument 1717 von Köthen aus geprüft und abgenommen. In seiner Leipziger Zeit war es das Instrument, auf dem sich Bach in Leipzig zu den Amtshandlungen der Universität und zu besonderen Konzerten mit der Vorstellung eigener Werke hören ließ.
Klanglich sollte dem Instrument die Disposition von Johann Christoph Bach für die Georgenkirche in Eisenach zugrunde liegen. Zu Johann Sebastian Bachs Kindheit war er dort Stadtorganist. Johann Sebastian ist dort getauft und erlebte den Bau des Instrumentes. Thüringen, Nord-Hessen mit Marburg gehören seit Jahrhunderten zum Mitteldeutschen Kulturkreis. Namhafte Orgelmacher haben in Thüringen und im Nord-Hessischen gearbeitet. In Thüringen waren die Wurzeln der „Bachs“. J.S. Bach hat hier Organistenämter bekleidet und die meisten seiner Orgelwerke komponiert.
Das Instrument steht einen halben Ton höher als heute üblich, im Chorton (466 Hz), für das Orgelwerk, das dadurch in besonderer Weise mit seinem strahlenden Klang und gleichzeitiger Monumentalität mit zwei 32 Füßen erlebbar wird. Die Bach Orgel kann aber je nach Anforderung mit ihren vier Manualen und Pedal, ihrem ganzen Registerfundus in der Farbigkeit eines Kantaten Orchesters einen Ganz- Ton tiefer im Kammerton (415 Hz) gespielt werden.
Bach pflegte des Öfteren zu sagen, dass er eine „recht große und recht schöne Orgel zu seinem persönlichen Gebrauch“ haben wolle.
Sich als Hörende auf Intuition einlassen
Seit 2014 ist Sohn Claudius MayWoehl in der Werkstatt WOEHL ORGEL PROJEKTE tätig. Die “composition“ der Instrumente und die “harmonisation“ machen wir gemeinsam. Aber – kann das gehen? Nur wenn sich beide als Hörende begegnen. 2019 konnten wir eine kleinere Orgel in Köln-Mülheim fertig stellen. Ein zweimanualiges Werk mit vielen Einzelfarben in einem kleinen, schönem Raum. Das Instrument steht frei im Raum, nach allen Seiten klangdurchlässig zu den reflektierenden Wänden. Der Raum wird zum Klangraum und Spieler und Hörer ist mittendrin.